Vom Umgang mit Nicht-Wissen

Category Error
Wir begegnen in unserer Arbeit mit öffentlichen Organisationen vor allem Herausforderungen, die in jene Kategorie fallen, die Horst Rittel und Melvin Webber schon vor 50 Jahren treffend als „wicked" charakterisiert haben. Sie zeichnet unter anderem aus, dass sie alle einzigartig und kaum miteinander vergleichbar sind. Oft wissen wir zudem erst im Nachhinein, womit wir es eigentlich genau zu tun hatten. Erst rückblickend werden all die Verzweigungen, Hürden und Ressourcen sichtbar, denen wir in einem "Projekt" (mitsamt oft seinen recht willkürlichen Anfängen und Abschlüssen) begegnet sind. Und erst im Nachgang wissen wir, wie erfolgreich ein Projekt nun eigentlich wirklich war. Das macht diese Herausforderungen so verzwickt: Wir handeln in die Zukunft gerichtet, aber wir lernen immer durch den Blick zurück. Wir haben es also stets mit einer Art Noch-Nicht-Wissen zu tun.
Das ist bemerkenswert – vor allem, wenn wir uns vor Augen führen, dass in unseren Organisationen der Umgang mit diesem Noch-Nicht-Wissen üblicherweise darin besteht, alles zu tun, es bloß nicht zuzulassen, einzugestehen oder sogar zu bemerken. Die Strategien dafür sind vielfältig und kreativ: Wir erstellen Experten-Kommissionen und Berichte über Zukunftsszenarien und Trends, entwickeln fein ausdifferenzierte Reporting-Standards, um frühzeitig Abweichungen von unseren geplanten Pfaden zu bemerken. Wir etablieren hierarchische Organisationsstrukturen, komplizierte regulatorische Rahmenbedingungen und Vorgaben, die das Noch-Nicht-Wissen über die Zukunft in zumindest ein Immer-Noch-Wissen über die Erfahrungen und Entscheidungen der Vergangenheit übersetzen. Und nicht zu vergessen: wir belohnen immer wieder jene Führungsstile, die auch im Angesicht größter Krisen, Sicherheit und Orientierung zu vermitteln versuchen.
Viele (auch wir) sprechen hier immer wieder von einem Kategorie-Fehler, einem falschen Einsortieren der Herausforderungen, mit denen wir es zu tun haben. Denn, so die dahinter liegende These, all die "wicked problems", mit denen wir uns in unserer Arbeit befassen, sind höchst komplex, dynamisch und vernetzt. Die Versuche, sie so zu behandeln, als wären sie bloß komplizierte, lineare Probleme, laufen also notwendigerweise ins Leere. Die Versuchung liegt also nahe (übrigens gerade für Berater*innen), diese “unterkomplexen” Versuche abzutun, als "alte Welt", die die wahre Dimension der Aufgaben, mit denen sie es zu tun hat, einfach noch nicht begriffen hat (im Gegensatz zu uns natürlich) – sei es aus Ratlosigkeit, aus Angst oder Besitzstandsdenken. Eine einfache und verlockende Geschichte, die sich extrem gut verkauft, und dabei ironischerweise in die gleiche Falle tappt, die sie bei anderen zu erkennen meint. Denn, so unsere These: Vielleicht trotten uns unsere angeblich ewig gestrigen Institutionen ja gar nicht träge hinterher, sondern sind uns in Wahrheit zwei Schritte voraus!
It’s not a bug, it’s a feature!
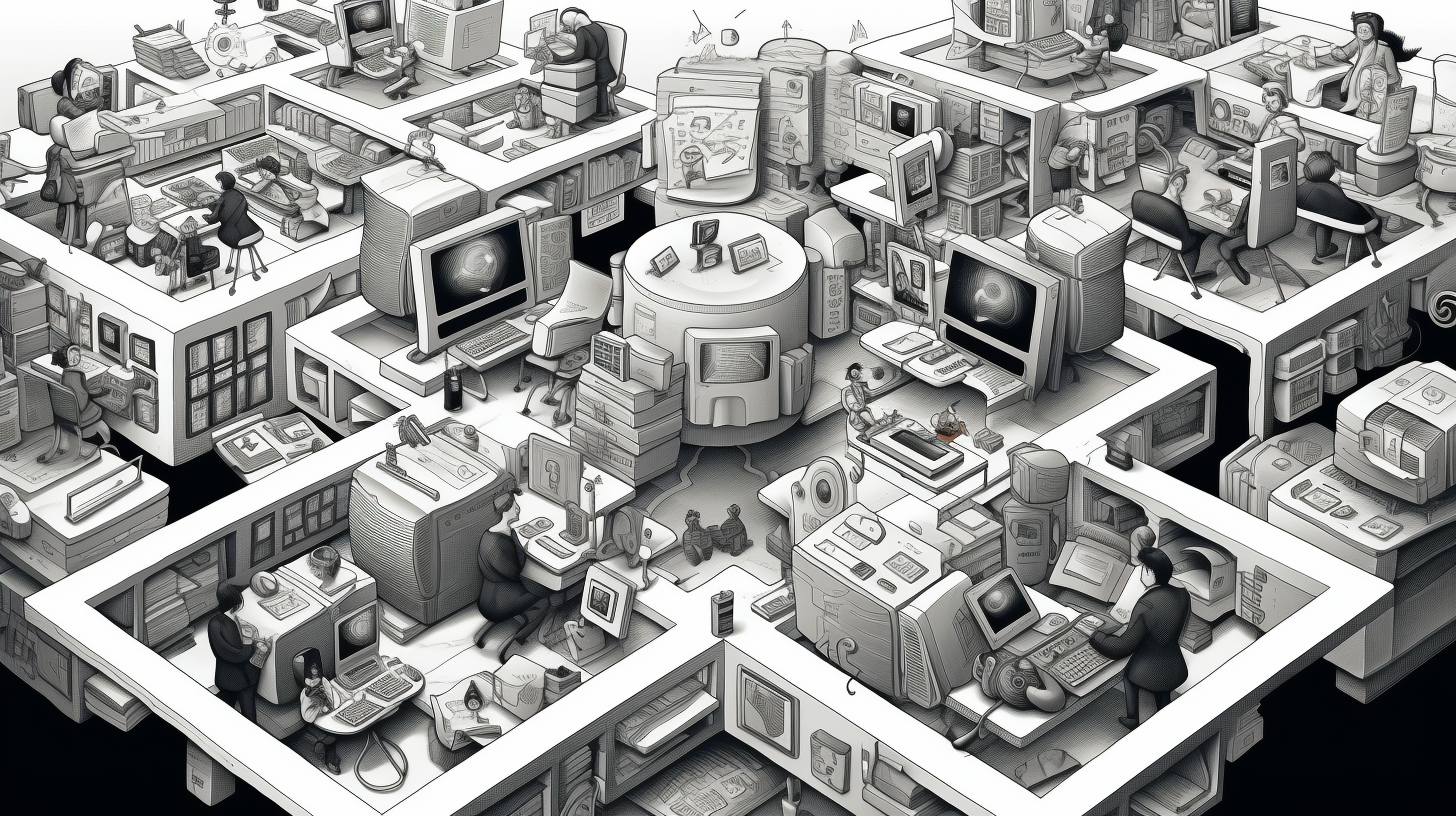
Schauen wir genauer hin, dann wird deutlich, dass die beschriebene Vermeidung, Verdrängung und Vereinfachung von Unsicherheiten nicht etwa eine Schwäche, sondern die eigentliche Kernfunktion einer jeden resilienten Organisation ist. Die Reduktion von Komplexität ist Organisation von Komplexität – und dabei notwendigerweise immer selektiv, also immer ein Prozess des Filterns, des Übersetzens und Unterscheidens. Nur so kann die (mehr oder weniger) strukturierte Innenseite einer Organisation aufrechterhalten werden im Angesicht der chaotischen Umwelt da draußen.
Was bedeutet das nun für unseren Blick auf die Herausforderungen in der Öffentlichen Innovationsarbeit? Zunächst einmal: Eine Verwaltung, eine Stiftung, ein Unternehmen ist nicht per se dysfunktional, wenn sie in extrem langsamen und trägen Prozessen immer und immer wieder dieselben Ergebnisse produziert und dabei an der "Realität" vorbei lebt. Im Gegenteil: Eine solche Organisation ist höchst effektiv darin, die unterschiedlichsten Irritationen von außen robust und verlässlich zu absorbieren. Sie hat also einen besonders effektiven Umgang mit Komplexität gefunden, sie lebt längst Resilienz und Anpassungsfähigkeit. Und gerade weil sie so effektiv darin ist, versteht sie es für gewöhnlich sehr gut, jedwede Versuche andere, neue, gar unklare Prozesse und Methoden unmittelbar zu entschärfen, bevor sie ihr wirklich gefährlich werden könnten.
Diese im wahrsten Sinne überlebenswichtige Ressource ist unser aller große Herausforderung. Denn während aus Sicht unserer Institutionen ihr eigenes Verhalten in der Vergangenheit durchaus „erfolgreich" war, müssen wir leider ergänzen, dass praktisch all die Krisen, mit denen wir es heute zu tun haben, die Konsequenzen genau dieser „Erfolge" sind. Die Filter-Mechanismen unserer Organisationen sind heute so effektiv geworden, dass sie selbst dramatische Entwicklungen wie eine planetare Polykrise einfach wegabsorbieren: als vernachlässigbare Externalitäten, als “Nicht-Zuständigkeiten”, als Rauschen. Was für unsere Organisationen überlebenswichtig ist, kann für ihre Umwelt lebensgefährlich werden. Das Problem: Diese Umwelt sind wir selbst.
Das ist die wirklich interessante Ausgangslage für die Gestaltung öffentlicher Innovationsprozesse: Die Krux ist immer der Umgang mit Unsicherheit. Denn wenn wir vorschlagen, all die ehemals herausgefilterten Externalitäten nun plötzlich in unseren Organisationen mitzubedenken, dann erreichen wir vor allem eins: Wir stellen die vielen stabilisierenden Routinen und Antworten der Vergangenheit in Frage und lösen damit faustisch all jene Reaktionen aus, die wir ja eigentlich überwinden wollten.
Eine Typologie des Nicht-Wissens

Was also tun? Das haben wir uns auch gefragt und uns entschieden, einen genaueren Blick auf diese Unsicherheit zu wagen. Wir wollten besser begreifen, was es genau mit diesem Noch-Nicht-Wissen auf sich hat und wie wir im Umgang damit einen wirklich neuen Weg einschlagen könnten. Dazu haben wir uns Unterstützung von Vaughn Tan geholt: Vaughn ist Assistant Professor der School of Management am University College London. Er hat in Harvard über Organisationsverhalten promoviert und forscht seit vielen Jahren zu den Grenzen von Unsicherheit, Risiko und Nicht-Wissen. Und er hat sich die Zeit genommen, sich ausführlich mit uns über Strategien, Unterschiede und unterschiedliche Formen von Nicht-Wissen zu unterhalten.
Vaughn unterscheidet dabei gleich fünf Arten von Nicht-Wissen, nämlich die Unsicherheit darüber 1) welche Handlungsoptionen es gibt, 2) welche möglichen Ergebnisse und 3) welche Wirkungsketten zu erwarten sind. Hinzu kommen 4) unklare Bewertungsmaßstäbe (also wie wir zwei Ziele im Verhältnis zueinander bewerten) und 5) das, was wir gemeinhin als Risiko bezeichnen, also die Abwägung von Wahrscheinlichkeit und Schadenshöhe. Wir können also von einer Typologie des Nicht-Wissens sprechen. Spannend ist diese Typologie deswegen, weil sie uns helfen kann, die Herausforderungen, mit denen wir es zu tun haben, etwas differenzierter zu betrachten, als es die Unterscheidung komplex vs. kompliziert zulässt. Genauer gesagt ergeben sich hieraus (mindestens) vier Arten von Problemen:
- Das Such-Problem: Daten und Wissen sind prinzipiell verfügbar, liegen aber (noch) nicht vor. Es geht also um die effiziente Suche und Auswertung von andernorts bestehendem Wissen.
- Das Ethik-Problem: Das Nicht-Wissen darüber, was wir moralisch wie bewerten. Der Weg liegt hier im Diskurs und der Auseinandersetzung mit ethischen Prinzipien. Hier gibt es keine richtige oder falsche Antwort, sondern nur Verantwortung und den gesellschaftlichen Austausch über Werte. Spannend wird es immer dann, wenn wir es mit einem Werte-Konflikt zu tun haben.
- Das Imaginationsproblem: Das Nicht-Wissen darüber, was überhaupt möglich wäre, welche Handlungsoptionen zur Verfügung stehen und auf welche wünschenswerten Zukünfte wir eigentlich zusteuern, welche Alternativen wir schon heute leben könnten.
- Das Experimentier-Problem: Eigentlich ein Zukunfts-Problem, bei dem es um Wissen geht, das prinzipiell erst durch Experimentieren, Erleben und Erfahren erlangt werden kann. Dahinter steht die Abwägung von Kosten und Mehrwerten, dieses Lernen zu ermöglichen. Und die Möglichkeit, ein solches erfahrenes Wissen wirklich weiterzugeben.
Wir fragen uns, wie sich unsere Organisationen verändern, wenn wir anfangen, mit diesen Typologien zu arbeiten und zu spielen. Wie könnten Mischformen aussehen? Hybride Organisationen, die mit einem Bein in der notwendigen Stabilisierung-Logik der Vergangenheit verwurzelt sind und mit dem anderen einen neuen, reflektierten Umgang mit ihrem eigenen Nicht-Wissen finden? Gibt es dafür schon Beispiele, von denen wir alle lernen können?
Vielleicht wäre schon viel gewonnen, wenn wir akzeptieren lernen, dass ein wirklich neuer Umgang mit unserer eigenen Unsicherheit nicht darin besteht, gleich wieder mit dem nächsten Erfolgsrezept, der nächsten Strategie oder Framework um die Ecke gelaufen zu kommen. Stattdessen könnten wir den Blick darauf richten, die eigene Toleranz auszubauen, Nicht-Wissen wirklich aufrecht- und damit auszuhalten. Vaughn betont, dass wir uns vielfach angewöhnt haben, dieses Aushalten mit fast körperlichem Unwohl zu assoziieren. Dabei muss das vielleicht gar nicht sein. Wir können uns drei Schritte vorstellen, die es auf diesem Weg zu gehen lohnt:
Neue Wege

Wir glauben, der erste Schritt ist die Erkenntnis selbst: Wir alle arbeiten in Organisationen, deren Zweck es ist, sich selbst zu erhalten. Und das tun sie intuitiv erstmal genau so, wie sie es offenbar erfolgreich in der Vergangenheit getan haben: Durch die Organisation von Komplexität in Form von Strategien, Geschichten, Regeln und Routinen. Der Umgang mit einer komplexen Welt ist also nichts, das wir neu erlernen müssten – im Gegenteil, unsere Organisationen sind so gut darin geworden, dass dieser Umgang auf Kosten eben dieser Welt stattfindet. Die Aufgabe lautet nun, diese oft unter größtem Aufwand externalisierten Kosten nun wieder innerhalb unserer Organisationen begreifbar zu machen. Es geht also viel weniger um das Erlernen neuer Strategien als um das Verlernen der alten.
Zweitens braucht es eine neue Ehrlichkeit im Umgang mit einer Welt voller Herausforderungen, die nun mal einfach nicht steuerbar sind. Das Eingeständnis, dass es oft gar keine eindeutig gute Lösung gibt und wir uns immer mit Abstrichen zufrieden geben müssen, fällt gerade öffentlichen Organisationen besonders schwer – auch, weil es hier immer wieder um öffentliche Meinungen und politische Diskurse, um Stabilität und Verlässlichkeit, und nicht zuletzt um regulatorische Rahmenbedingungen geht, die nach einem anderen Prinzip funktionieren. Das allgemeine Eingeständnis von zumindest teilweisem Nicht-Wissen in Bezug auf die eigenen Aufgaben kommt dort für gewöhnlich nicht gut an. Sei es noch so ehrlich.
Und drittens geht es darum, pro-aktiv und produktiv mit dem eigenen Nicht-Wissen umzugehen. Also eben nicht vor lauter Unsicherheit in Lähmung oder Ignoranz verfallen. Wir glauben, dazu gehört zunächst auch ein differenziertes Wissen über Nicht-Wissen selbst. Denn daraus lassen sich unterschiedliche Strategien ableiten. Denn Rauschen ist nicht gleich Rauschen. Eine Typologie des Nicht-Wissens kann hier ein sehr produktiver Anfang sein.
Ob das reicht? Wir vermuten, es gibt noch viele Perspektiven darauf, wie öffentliche Organisationen der Zukunft handeln können, die wir selbst noch gar nicht kennen – unser eigenes Imaginationsproblem also. Das ist ok, denn wir haben gelernt: Wir wissen es noch nicht.
